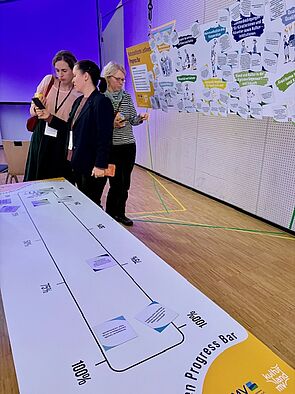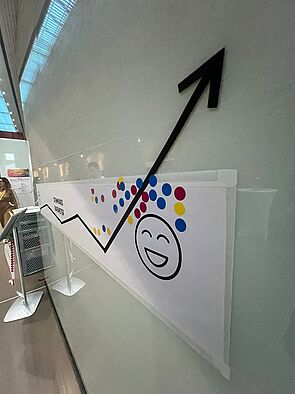#LKKMV25 – die Landeskulturkonferenz im Liveticker
Die Landeskulturkonferenz am Donnerstag in Neubrandenburg. Das Thema lautet: Kulturelle Grundversorgung. Wie können Kulturangebote zuverlässig auch in herausfordernden Zeiten gesichert werden? Hier unser Liveticker. #LKKMV25
- Das Programm der Landeskulturkonferenz – hier
- Das Interview mit Bettina Martin zur Landeskulturkonferenz: www.kultur-mv.de
- Die Landeskulturkonferenz 2025 – hier geht's zum Livestream
- Alle Infos: landeskulturkonferenz-mv.de
9:50 Uhr
Willkommen im Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg! Das Interesse an der Landeskulturkonferenz ist groß. Rund 350 Kunst- und Kulturschaffende aus MV sind der Einladung gefolgt. Geplant sind Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden.
10:05 Uhr
Los geht's. Susan Ihlenfeld, Josefin Ristau und Tim Tonndorf (Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz) singen „Bella Ciao“ aus dem Programm „If I Can’t Dance It’s Not My Revolution.“
10:15 Uhr
Kulturministerin Bettina Martin eröffnet die Landeskulturkonferenz. „Flagge zeigen: Kultur stark machen!“ lautet das Motto. Es geht um Kulturelle Grundversorgung. Um Daseinsvorsorge. Zusammenhalt. Gemeinschaft und Perspektiven. Und natürlich auch Finanzen. Denn: „Kunst ist keine freiwillige Nebensache, sondern ein Grundpfeiler des gesellschaftlichen Miteinanders“, so die Ministerin. Gleichwohl stehe die Kultur auch in Deutschland vor großen Herausforderungen. Finanziell, weil viele kommunale Kassen klamm seien. Aber auch aus politischer Sicht. „Was tun, wenn die sogenannte Leitkultur den Maßstab bilden soll? Politisch motiviert und nicht an Vielfalt und künstlerischen Kriterien orientiert?“ Auch darüber solle heute diskutiert werden.
Das Interview mit Bettina Martin zur Landeskulturkonferenz: www.kultur-mv.de
10:40 Uhr
„Warum Kultur auch immer wehtun muss?“ In seiner Keynote spricht Kabarettist Silvio Witt über die Rolle von Kultur. Der ehemalige Oberbürgermeister von Neubrandenburg und Vorsitzender des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern im Deutschen Bibliothekenverband weiß, wovon er spricht. „Bibliotheken werden jetzt schon angegriffen“, sagt er. Wegen Projekten über queere Literatur zum Beispiel.
Kultur dürfe unbequem sein. Kultur dürfe aber auch Spaß machen, so Witt. Lacher seien wichtig. „Lassen Sie uns mit Zwinkern in den nächsten Jahrzehnten Kunst und Kultur zelebrieren. Auch wenn wir nicht voll zufrieden sind. Das ist wichtig für unsere Freiheit im Land.“
11 Uhr
Die Podiumsdiskussion beginnt. Thema: Kulturelle Grundversorgung. Im Podium sitzen: Moderatorin Dörthe Graner. Antje Theise, Direktorin der Universitätsbibliothek Rostock und Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes. Kulturministerin Bettina Martin. Imke Freiberg, Leiterin des soziokulturellen Zentrums St. Spiritus in Greifswald. Marion Schael vom Landeskulturrat (von links nach rechts oben im Bild). Zentrale Frage ist: Was ist kulturelle Grundversorgung und wie kann sie gelingen?
11:45 Uhr
Musik, Theater, Bücher, Soziokultur – für Marion Schael ist kulturelle Grundversorgung alles, was Menschen verbindet und zusammenbringt. „Sie ist der Kit, der uns zusammenhält.“ Sie am Leben zu halten und ihren Wert zu schätzen, habe viel mit kultureller Bildung zu tun. Und die könne nicht früh genug beginnen. Der Grundstein dafür müsse schon in Kitas und Schulen gelegt werden.
Diese Erfahrung hat auch Kulturministerin Bettina Martin gemacht. Sie erzählt, dass ihr Weg zur Kultur über die Schule führte. Als Kind sei Kultur bei ihr zu Hause kein großes Thema gewesen. Ihr Tor in die Kulturwelt habe eine Lehrerin aufgestoßen, die Partituren mit Farben erklärt habe und mit der Klasse in Konzerte gegangen sei. Bettina Marin wirbt auch deshalb darum, in bildungspolitischen Diskussionen Fächer wie Deutsch, Mathe oder Sport nicht gegen Kunst auszuspielen. Und Angebote wie „Kunst für Schule“ rege zu nutzen. Forderungen nach mehr finanzieller Unterstützung könne sie gut verstehen: „Jeder Euro in Kultur ist ein gut investierter Euro.“ Angesichts klammer Kassen von Land und Kommunen seien hier jedoch dicke Bretter zu bohren.
Imke Freiberg betont, dass kulturelle Grundversorgung kein Selbstläufer sei. Sie steht und fällt mit Menschen, die sie anbieten. Mit Menschen, die sie nutzen. Und mit Geldern, die die Angebote erst ermöglichen. „Kulturelle Grundversorgung aufs Land zu bringen, ist nicht schwer. Sie dort zu halten, dagegen sehr.“ Sie wirbt darum, nicht immer nur in Vereinsstrukturen zu denken, sondern – insbesondere bei Förderungen – auch für andere und flexiblere Modelle offen zu sein.
Antje Theise macht darauf aufmerksam, dass in den vergangenen Jahren etliche Bibliotheken im Land geschlossen wurden. Insbesondere Vorpommern-Rügen sei in diesem Punkt ein weißer Fleck auf der Karte. In vielen Köpfen existiere noch immer die Vorstellung, Bibliotheken seien Orte, an denen einfach nur Bücher über den Tresen geschoben werden. „Auch Bibliotheken sind mit ihren Angeboten längst im 21. Jahrhundert angekommen!“ Ihr Wunsch: Dass das Land mehr in mobile Angebote investiere, zum Beispiel in moderne Fahrbibliotheken. Für Antje Theise sollten Bibliotheken schon bei der Stadtentwicklung als Teil der Grundversorgung viel stärker als bisher mitgedacht werden – zum Beispiel beim Bau von Grundschulen.
13 Uhr
Drei Workshops starten. Teilnehmende diskutieren über „Brücken bauen mit Kultur“, über „Engagiert in der Kultur“ und über „Kultur macht Stadt“. Ist Kultur in allen Bereichen Teil der Grundversorgung?
Brücken bauen mit Kultur. Der Workshop zeigt: Kultur ist auch Schutzraum. Paulina Mehner, Kulturbörse Gnoien: „Unsere Börse ist Mehrgenerationenhaus, Kulturtreff und Begegnungsstätte. Bei uns treffen Leute aufeinander, die sich sonst nicht kennenlernen würden. Wir erleben auch viel Misstrauen und merken, dass wir aktiv auf die Menschen zugehen müssen. Dafür machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Das ist wichtig für die Sichtbarkeit.“ Das bestätigen auch weitere Teilnehmende, unter anderen Ute Neumann von der Landeszentrale für politische Bildung und Fridolin Zeisler, Leiter der Kulturschule Malchin.
Engagiert für Kultur. Etwa 30 Prozent der Ehrenamtlichen deutschlandweit engagieren sich in der Kultur. „Die Freude der Menschen, sich für Kultur einzusetzen: Diese Grundstimmung ist Voraussetzung. Die begegnet mir sehr häufig“, sagt Hannelore Kohl von der Ehrenamtsstiftung.
Kultur macht Stadt. Kulturangebote in sogenannten Großwohnsiedlungen sind vor allem in Rostock und Schwerin herausfordernd. Schulprojekte benötigen besondere Betreuung. Seit 2024/25 gibt es einen neuen Förderfonds in Höhe von 300.000 Euro mit dem Schwerpunkt Nordost/Nordwest.
Alle drei Workshops sind sehr gut besucht. Die Teilnehmende diskutieren offen über Herausforderungen und Lösungswege, die einzelne Kulturschaffende bereits gehen.
13:45 Uhr
Über Kunst wird nicht nur gesprochen. Sie wird auf der Konferenz auch gezeigt. Zum Beispiel bei Sascha Steffen von der Kunstschule Neubrandenburg. Wer möchte, kann an seiner Pixelart-Station kleine Noppensteine zu Bildern zusammensetzen, mit Farbe bestreichen und auf Papier drucken. Judy Salewski hat es ausprobiert – und nimmt nun eine kunstvolle Erinnerung mit nach Hause.
14:15 Uhr
Mit einem Wimpernschlag Musik machen? Bei Tanja Pfefferlein kein Problem! Sie hat einen MotionComposer dabei. Er verwandelt jede Bewegung in Töne, und sei sie auch noch so klein. Mareike Kochansky (Medienpädagogin) und Jana Sonnenberg (Fredak MV) haben es ausprobiert. Gedacht ist das Angebot zum Beispiel für inklusive Theater- oder Tanzprojekte.
15:30 Uhr
Das abschließende Panel resümiert die sechs Workshops der Landeskulturkonferenz. Den Workshop „Engagiert für Kultur“ fasst Frauke Lietz so zusammen: „Kultur ohne Ehrenamt – das wäre unvorstellbar. Gutes Engagement braucht jedoch auch gute Rahmenbedingungen.“ Sie weist Kulturschaffende auch auf die Mikroförderungen der Ehrenamtsstiftung hin.
Für den Workshop „Neue Wege auf dem Land“ sagt David Adler, dass die Kulturszene trotz viele Widrigkeiten bereits viel bewege. Die Erfahrung zeige, dass Kunst an dieser Stelle gleichzeitig auch ein Mittel der Regionalentwicklung sei. Sie schaffe Verbindung und Gemeinschaft. Daraus seien so manches Mal schon über ein Projekt hinaus neue Ideen und Allianzen entstanden.
Für den Workshop „Brücken bauen mit Kultur“ sagt Katharina Gronow: „Kulturelle Bildung hängt eng zusammen mit politischer Bildung.“ Sie verweist auf die fünf Demokratiezentren sowie diverse Partnerschaften für Demokratie im Land. Und wirbt darum, stets im Gespräch und offen für Begegnungen zu bleiben.
Für den Workshop „Kunst und Kultur stark machen“ sagt Imke Freitag: Kulturelle Grundversorgung dürfe nicht nur in die ländliche Region blicken, sondern müsse auch Stadtteile mitdenken. So oder so spiele Vernetzung dabei eine große Rolle. Als konkretes Ergebnis verweist sie auf „Zusammen bewegen“, ein Netzwerk, das sich aus dem Workshop heraus gebildet habe und nun wachsen soll.
Für den Workshop „Kultur macht Stadt“ sagt Kristina Koebe: Kultur dürfe nicht einfach wie ein Ufo in einem Stadtteil landen, sondern müsse sich entwickeln, die Menschen vor Ort mitnehmen. Als gelungene Beispiele dafür verweist sie auf die Kulturförderung der Stadt Rostock sowie auf den Verein „Die Platte lebt“ in Schwerin.
Für den Workshop „Kultur mit Plan“ verweist Stephanie Kracht beispielhaft auf Stralsund. Die Stadt habe mit ihrem „Kulturkonzept Stralsund 2034“ einen breiten Prozess der Beteiligung angeschoben und Maßnahmen entwickelt, die nun Stück für Stück umgesetzt werden sollen. Ähnlich sei es bei den kulturpolitischen Leitlinien des Landes. Pläne wie diese seien ein Kompass für kulturelle Entwicklungen.
Die Landeskulturkonferenz 2025
- Das Programm der Landeskulturkonferenz – hier
- Alle Infos: landeskulturkonferenz-mv.de