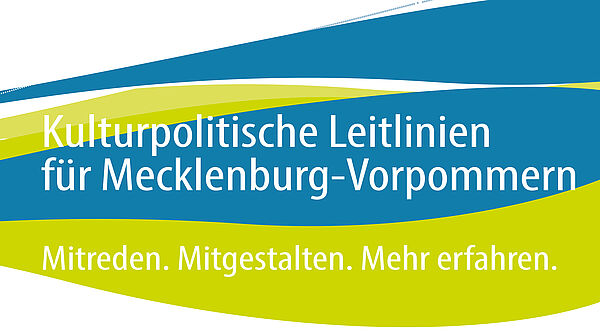Zum Reinhören: die Leitlinien-Podcasts
Zehn Leitlinien plus eine Präambel = elf Podcasts. Was steht in den Leitlinien? Wie sind sie zustande gekommen? Oliver Kramer (wellenrauschen-mv.de) hat bei Dr. Michael Körner (Vorsitzender des Landeskulturrates), Marion Schael (Kunst- und Kulturrat Vorpommern-Rügen), Ralph Kirsten (Kulturrat der Hansestadt Rostock) und Dr. Jan Hofmann (Sachverständiger des Landeskulturrates) nachgefragt. Unser Angebot zum Reinhören (unten) und Mitlesen (auf der Seite rechts).
Präambel
Leitlinie 1: Wertschätzung und Anerkennung
Kunst und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern sind unverzichtbare gesellschaftliche Werte, die geschützt und gefördert werden. Zu ihrer Entfaltung sind Respekt, Wertschätzung und Anerkennung unerlässlich. Dazu Marion Schael vom Kunst- und Kulturrat des Landkreises Vorpommern-Rügen.
Leitlinie 2: Gemeinsame Verantwortung für Kunst und Kultur
Die Förderung von Kunst und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern liegt in gemeinsamer Verantwortung von Land, Landkreisen und Kommunen sowie der Zivilgesellschaft. Diese Aufgabe wird gleichberechtigt und im Dialog wahrgenommen. Dazu Ralph Kirsten vom Kulturrat der Hansestadt Rostock.
Leitlinie 3: Kommunikation und Kooperation
Kulturpolitik für Mecklenburg-Vorpommern gestalten, das heißt: Impulse zum gemeinsamen Handeln im Sinne eines Kulturlandes geben. Dies erfordert einen regelmäßigen, verlässlichen, transparenten und gleichberechtigten Austausch und Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Ebenen, Bereichen und Handelnden der Kulturszene im Land. Dazu Ralph Kirsten.
Leitlinie 4: Rahmenbedingungen für Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinstitutionen
Die zukunftsfähige Kulturentwicklung des Landes benötigt günstige Rahmenbedingungen für die finanzielle, strukturelle und personelle Absicherung der kulturellen und künstlerischen Angebote in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu Dr. Jan Hofmann aus dem Landeskulturrat Mecklenburg-Vorpommern, Sachverständiger und Kulturstaatssekretär a.D.
Leitlinie 5: Qualität und Qualifikation
Die Entwicklung von Qualitätsstandards für die Kulturarbeit in dialogischen Verfahren und die regelmäßige, auf die Bedarfe orientierte Qualifizierung der Kulturakteurinnen und -akteure sind ständig zu erfüllende Aufgaben im Rahmen der Kulturpolitik und im Sinne einer zukunftsfähigen Kulturentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu noch einmal Ralph Kirsten.
Leitlinie 6: Kulturelle Bildung
Das Recht auf lebenslanges Lernen schließt die Kulturelle Bildung ein. Sie ist Bestandteil eines modernen Bildungsverständnisses, in dem kultur-, bildungs- und sozialpolitische Impulse zusammenfließen. Kulturelle Bildung gewährleistet den Zugang zu Kunst und Kultur sowie den Erwerb und die Entwicklung von kulturellen Fähigkeiten. Dazu Marion Schael.
Leitlinie 7: Diversität und Teilhabe
Jeder Mensch hat ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Kulturelle Teilhabe und aktive kulturelle Betätigung werden für alle Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen und Ausgangsbedingungen uneingeschränkt und lebensbegleitend ermöglicht. Dazu Marion Schael.
Leitlinie 8: Kulturelle Angebote für Stadt und Land
Die Lebensqualität zeigt sich auch in der Identifikation der Menschen mit ihrer Region. Unabhängig davon, ob der jeweilige Lebensmittelpunkt auf dem Lande oder in der Stadt liegt, werden für alle Menschen kulturelle Angebote vorgehalten, die erreichbar und zugänglich sind. Dazu noch einmal Marion Schael.
Leitlinie 9: Kunst und Kultur in der digitalen Gegenwart und Zukunft
Das digitale Zeitalter beeinflusst den Kunst- und Kulturbetrieb in seiner Gesamtheit. Kunst und Kultur übernehmen im Zusammenspiel von analoger und digitaler Welt eine Vermittlungsfunktion. Ein offener und kritischer Diskurs über Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung sowie die aktive Gestaltung im Kunst- und Kulturbetrieb ist deshalb permanent und unerlässlich. Dazu: Dr. Jan Hofmann.
Leitlinie 10: FreiRäume für Kunst und Kultur
Zu Kunst und Kultur gehören FreiRäume. Aus ihnen erwachsen Kreativität und Innovationskraft. Diese FreiRäume bedürfen der Akzeptanz, des Schutzes und der öffentlichen Förderung. Dazu Dr. Jan Hofmann.